- / STARTSEITE
- / Innovation
- / Forschung & Entwicklung
- / Abgeschlossene Forschungsprojekte
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
„Meine persönliche Motivation: Das Forschungsergebnis bis zum Produkt führen.“
- Prof. Dr. Michael Heuken, Vice President Advanced Technologies
Das Trainings-Netzwerk zur Ausbildung junger Wissenschaftler mit dem Titel "Piezoelectric Energy Harvesters for Self-Powered Automotive Sensors: From Advanced Lead-Free Materials to Smart Systems (ENHANCE)" bietet jungen Wissenschaftlern (Early Stage Researcher, ESR) eine umfassende und intensive Ausbildung in einem multidisziplinären Forschungs- und Lehrumfeld. Zu den wichtigsten Schulungsthemen gehört die Entwicklung von Energiequellen (Energy Harvesters), die mit der MEMS-Technologie kompatibel sind und in der Lage sind, drahtlose Sensoren zu betreiben. Diese Technologie, die auf Automobile angewendet wird, ermöglicht 50 kg Gewichtseinsparung, Vereinfachung der Verbindungen, Platzersparnis und geringere Wartungskosten - alles wichtige Schritte zur Schaffung umweltfreundlicher Fahrzeuge. Weitere wichtige Themen sind Technologieinnovation, Bildung und Persönlichkeitsbildung.
ENHANCE vernetzt weltweit führende Forschungsgruppen an akademischen Einrichtungen, um einen kombinierten, integrierten Ansatz aus Synthese/Herstellung, Charakterisierung, Modellierung/Theorie in Verbindung mit Konzepten zur Materialintegration in Geräte und Systeme zu bieten. Ein solcher wissenschaftlich gestützter Gesamtingenieuransatz wird zu effizienten piezoelektrischen Energiewandlern führen, die für die Automobilindustrie geeignet sind. Die ESRs werden sich auf dieses gemeinsame Forschungsziel konzentrieren und dabei einen multidisziplinären Bottom-up-Ansatz anwenden, der sich wie folgt zusammenfassen lässt: "neues Molekül - fortschrittliches Material – neue Bauelemente - intelligentes System". Der Hauptzweck des ENHANCE-Projekts ist die Schaffung einer multidisziplinären gemeinsamen Forschungsaktivität, die Chemie, Materialwissenschaft, Physik, Mechanik, Technik und Elektronik umfasst, um Energiequellen mit hoher Leistungsdichte und Systeme daraus mit stabilisierter Ausgangsspannung im Bereich von 1-3 V zu schaffen. Diese sollen an die spezifischen Bedürfnisse von Sensoren mit hoher Autonomie angepasst sein und in Temperaturbereichen von Raumtemperatur (RT) bis 600 °C in Fahrzeugen arbeiten. Wir schlagen vor, eine hybride Nutzung der in den Autos verfügbaren Energien zu entwickeln die Wärme (Th), Licht (Lt), Vibration (vi)) und/oder mehrere Umwandlungseffekte gleichzeitig nutzen. Dabei sollen piezoelektrische (Pi) - pyroelektrische (Py) - elektromagnetische (EM) oder photovoltaische (PV) Effekte durch den gleichen Wandler basierend auf piezoelektrischen/ferroelektrischen/multiferroskopischen Kristallen, Schichten oder Nanostrukturen genutzt werden.
Der Ansatz der hybriden Energiegewinnung mit einem einzigen Wandler, der eine zeiteffiziente und vereinfachte Herstellung des Hybridsystems ermöglicht, steht im Einklang mit den Endzielen des Projekts. Diese sind die Schaffung von Systemen von Schwingungs-, Wärme- und Lichtenergiefängern nicht nur mit einer ausreichenden Effizienz der Energiegewinnung (300-500 μW/cm2/g2), sondern auch mit einem angemessenen Preis und tragfähigen Technologien zur Herstellung und Integration für industrielle Anwendungen.
Die moderne Gesellschaft stützt sich auf eine Vielzahl von elektrischen und elektronischen Einrichtungen, von der Kommunikation über die industrielle Fertigung bis hin zur E-Mobilität. Etwa 80% von ihnen benötigen die Umwandlung von Primärstrom in eine andere Form von Strom. Daher ist eine hocheffiziente elektrische Energieumwandlung entscheidend. Hauptsächlich hängt dies von den verwendeten Leistungsschalttransistoren ab, welche einen möglichst niederohmigen flächenspezifischen Einschaltzustand bei gleichzeitig hoher Sperrspannung aufweisen sollten. Neue Halbleitermaterialien mit hohem Bandabstand (WBG) wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) erreichen gegenüber Silizium eine höhere Durchbruchfeldstärke und können daher weit kompakter aufgebaut werden. Auf dieser Basis konnten bereits leistungselektronische Konverter mit höherer Effizienz demonstriert werden.
Das neue Halbleitermaterial Galliumoxid (Ga2O3) mit seiner gegenüber SiC und GaN mehr als doppelt so hohen Durchbruchfeldstärke besitzt das Potenzial den Wirkungsgrad von damit bestückten Leistungskonvertern noch weiter zu steigern. Daher besteht seit etwa sechs Jahren weltweites Interesse in der Erforschung neuer leistungselektronischer Halbleiterbauelemente auf Basis von Ga2O3. Ziel von ForMIkro-GoNext ist es, voll funktionsfähige vertikale Ga2O3-Transistoren zu demonstrieren. Zur Erreichung dieses Ziels, müssen Kristallzucht, Epitaxie und Prozesstechnologie weiterentwickelt und aufeinander abgestimmt werden.
Projektpartner: Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) / Ferdinand-Braun-Institut / Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH) / Universität Bremen / ABB / AIXTRON SE.
Das Verbundprojekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge, Großbritannien / University of Cambridge, Großbritannien / AIXTRON SE, Deutschland / Cambridge CMOS Sensors Limited, Großbritannien / Commissariat a l’ Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Frankreich / INTEL Performance Learning Solutions Limited, Irland / Thales SA, Frankreich / Centre National de la Recherche Scientifique, Frankreich / Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Schweiz / Danmarks Tekniske Universitet, Dänemark / Philips Technologie GmbH, Deutschland / Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Deutschland / Gesellschaft für angewandte Mikro- und Optoelektronik mit beschränkter Haftung AMO GmbH, Deutschland / The Provost, Fellows, Foundation Scholars & the other Members of Board of the College of the Holy & Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Irland / Graphenea S.A., Spanien
Die Verbundpartner haben bereits vielversprechende Ergebnisse bei der Entwicklung von III-V Mehrfachsolarzellen auf Silizium erzielt. Vor einer industriellen Nutzung müssen aber noch weitere Verbesserungen hinsichtlich Leistung der Bauelemente und Produktionskosten erreicht werden. Hierzu gehören konkret eine Reduktion der Versetzungsdichte in den III-V Solarzellenschichten von heute 108 cm-2 in den Bereich von 1-5*106 cm-2, die Demonstration von Solarzellen mit Wirkungsgraden > 30 % und die Optimierung der Wirtschaftlichkeit der MOVPE Wachstumsprozesse. Das vorliegende „MehrSi" Projekt adressiert die wichtigsten Entwicklungsschritte auf diesem Weg. Dabei sollen insbesondere die folgenden Ziele erreicht werden:
Die Hauptziele des SiTaSol-Projekts sind:
Nachweis einer zweipoligen, zweipoligen III-V/Si-Tandemsolarzelle mit einem Wirkungsgrad von > 26% und einem Ziel von 30% unter Verwendung von weniger als 5 µm III-V-Verbindungshalbleitermaterial. Diese Zelle wird einen Drop-In-Ersatz für die heutigen c-Si-Solarzellen mit minimalen Änderungen an der PV-Zelle und dem Modul ermöglichen.
Demonstration von PV-Prototypenmodulen (einschließlich 2-10 Zellen in Serie) mit einem Wirkungsgrad von > 24%.
Validierung von Prozessen zur Vorbereitung des Wachstumssubstrats, die mit den Kostenzielen von 0,05 € pro 243 cm2 Wafer kompatibel sind.
Validierung skalierbarer Epitaxieprozesse für die III-V-Absorberschichtabscheidung mit einer Wachstumsrate von 100 µm/h, einer Abscheidungseffizienz von 35% und einem V/III-Verhältnis von 3, die mit den Kostenzielen von 0,62 € pro 243 cm2-Wafer kompatibel sind, und Bau eines Reaktor-Prototyps mit einer Abscheidefläche von mindestens 100 cm2.
Untersuchung von Abfallbehandlungs- und Recyclingverfahren für Wasserstoff und Metalle, die aus dem III-V-Wachstum stammen und mit den Kostenzielen von 0,1 € pro 243 cm2 Wafer vereinbar sind.
Validierung skalierbarer Verarbeitungswege für III-V/Si-Tandemsolarzellen, die mit den Leistungs- und Kostenzielen kompatibel sind.
Durchführung einer detaillierten Lebenszyklus-Bewertung unter Berücksichtigung sozioökonomischer und ökologischer Aspekte.
Erstellung eines theoretischen Modells für die Energiegewinnung von PV-Modulen mit 2-poligen III-V/Si-Tandemzellen an verschiedenen europäischen Standorten.
Es sei darauf hingewiesen, dass sich das Projekt auf Schlüsselfaktoren für die Realisierung einer kostengünstigen c-Si-basierten Tandemsolartechnologie mit herausragendem Effizienzpotenzial weit über die Grenzen von Single-Junction-Geräten hinaus konzentriert.
Teilnehmer: AIXTRON SE, Deutschland / AIXTRON Ltd, Großbritannien / AZUR SPACE Solar Power GmbH, Deutschland / Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Deutschland / JOHANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Österreich / Leiden University, The Netherlands / Topsil Semiconductor Materials A/S, Denmark
Weitergehende Informationen; (Website SiTaSol hier)
Aristotle University of Thessaloniki, Griechenland / University of Patras, Griechenland / University of Oxford, Großbritannien / University of Surrey, Großbritannien / University of Ioannina, Griechenland / Ecole Polytechnique, Frankreich / Universität Stuttgart, Deutschland / Fraunhofer-Gesellschaft, Deutschland / Helmholtz Zentrum Berlin, Deutschland / Centro Ricerche Fiat, Italien / Centre for Research and Technology – Hellas, Griechenland / Horiba Jobin Yvon, Frankreich / Advent Technologies Griechenland / COATEMA, Deutschland / COMPUCON, Griechenland / AIXTRON, Deutschland / Konarka, Deutschland / Oxford Lasers Ltd., Großbritannien
Das APOLLON-Projekt betrifft die Optimierung und Entwicklung von Punktfokus- und spiegelbasierten spektrenselektiven-Photovoltaik-Konzentrationssystemen (Concentrator Photovoltaik, CPV) (Multiansatz). Die verschiedenen Technologiepfade werden mit besonderem Fokus auf die erkannten kritischen Fragen im Zusammenhang mit jeder Systemkomponente verfolgt, um die CPV-Effizienz zu erhöhen, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, Kosten und Umweltauswirkungen zu reduzieren. (Multi Junction, MJ) MJ-Solarzellen werden unter Verwendung neuer Materialien und Depositionstechnologien hergestellt. Diese sollen es ermöglichen, das in der Europäischen Strategischen Forschungsagenda für Konzentrationsphotovoltaik festgelegte Ziel der MJ-Solarzelleneffizienz zu erreichen und sogar zu übertreffen. Die Optimierung der Fresnel- und Prismenlinse sowie die Entwicklung neuer bildgebender, hochkonzentrierter, zellselbstschützender, stabiler Optiken ermöglichen eine hohe optische Effizienz und weite Akzeptanzwinkel. Neue Konzepte werden für spiegelbasierte Spektrensplitting-Systeme angewendet, die es ermöglichen, den Kühlbedarf zu eliminieren. Sowohl die optimierten als auch die neuen Technologien werden gründlich getestet, um zuverlässige CPV-Systeme mit langer Lebensdauer zu erhalten. Hohe Integration, die mit mikroelektronischen und automobilen Lichttechnologien für Hochdurchsatz-Montagetechniken erreicht wurde, zusammen mit intelligenten Lösungen für genaue, zuverlässige, kostengünstige Verfolgung und reduzierte Fehlanpassungsverluste werden im Projekt bearbeitet. Prototypische Systeme werden für eine vollständige ökologische und ökonomische Bewertung entwickelt, die schließlich zu einer wirtschaftlich attraktiven konzentrierenden Photovoltaik führt. In APOLLON werden alle Beteiligten, von Universitäten, KMU, Großunternehmen bis hin zum Endverbraucher, wissenschaftlich wertvolle, verwertbare und langlebige Produkte präsentieren, deren Ergebnisse in ganz Europa verbreitet und genutzt werden.
Teilnehmer: CESI RICERCA, Italien / AIXTRON SE, Deutschland / Centre National de la Recherche Scientifique - Laboratory of Photonics and Nanostructures, Frankreich / Energies Nouvelles et Environnment, Belgien / CENTRO RICERCHE PLAST-OPTICA, Italy, State Enterprise Scientific Research Technological - Institute of Instrument Engineering, Ukraine / Joint Research Centre (European Commission), EU / Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Italien / PV Technology Department of Electrical and Computer Engineering - University of Cyprus, Zypern / CPower, Italien / Solar*Tec AG, Deutschland / Energy research Centre of the Netherlands, Niederlande / ENEL Produzione S.p.A, Italien, FUNDACIÓN ROBOTIKER, Spanien, New and Renewable Energy Centre, Großbritannien / University of Ferrara, Italien
Gefördert von der Europäischen Kommission
CNR, Italien / ST Microelectronics, Italien / Epichem Limited, Großbritannien / CSIS, Spanien / Vilnius Universität, Litauen
Unsere moderne Gesellschaft hat enorm von neuartigen miniaturisierten mikroelektronischen Produkten mit verbesserter Funktionalität zu immer geringeren Kosten profitiert. Mit abnehmender Größe werden jedoch Verbindungen unabhängig von der Anwendungsdomäne zu großen Engpässen.
CONNECT schlägt Innovationen in neuartigen Verbindungsarchitekturen vor, um eine zukünftige CMOS-Skalierung durch die Integration von metalldotierten oder metallgefüllten Kohlenstoffnanoröhren (CNT) zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, strebt CONNECT die Entwicklung von Fertigungstechniken und -prozessen an, um zuverlässige CNTs für On-Chip-Verbindungen zu erhalten. Auch Herausforderungen der Übertragung des Prozesses in die Halbleiterindustrie und der CMOS-Kompatibilität werden behandelt.
CONNECT wird ultrafeine CNT-Leitungen und Metall-CNT-Verbundmaterial untersuchen, um die unmittelbar bevorstehenden Probleme des hohen Stromverbrauchs und der Elektromigration bei Kupferverbindungen nach dem derzeitigen Stand der Technik zu lösen. Es werden Demonstratoren entwickelt, die im Vergleich zum Stand der Technik mit herkömmlichen Kupferverbindungen einen deutlich verbesserten spezifischen elektrischen Widerstand (bis zu 10µOhmcm für einzelne dotierte CNT-Leitungen), Strombelastbarkeit (bis zu 108A/cm2 für CNT-Bündel), thermische und Elektromigrationseigenschaften aufweisen. Darüber hinaus wird CONNECT neuartige CNT-Verbindungsarchitekturen entwickeln, um die Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz auf Schaltungsebene und auf Architekturebene zu untersuchen.
Die in diesem Projekt entwickelten Technologien sind sowohl für die Leistung als auch für die Herstellbarkeit von Mikroelektronik im Maßstab 1:1 der Schlüssel. Sie werden eine erhöhte Leistungs- und Skalierungsdichte von CMOS oder CMOS-Erweiterungen ermöglichen und auch auf alternative Rechenschemata wie neuromorphes Rechnen anwendbar sein. Das CONNECT-Konsortium verfügt über starke Verbindungen entlang der Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung bis zum Endnutzer und vereint einige der besten Forschungsgruppen auf diesem Gebiet in Europa. Die Realisierung von CONNECT wird die Rückgewinnung von Marktanteilen des europäischen Elektroniksektors fördern und die Industrie auf zukünftige Entwicklungen der elektronischen Landschaft vorbereiten.
Freiberger Compound Materials GmbH (FCM), Deutschland / Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), Deutschland / Universität Ulm, Deutschland / Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik (MPI), Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

SOITEC, Frankreich / STMicroelectronics, Frankreich / AMD Saxony, Deutschland / SILTRONIC, Deutschland / DOLPHIN, Frankreich, CEA-LETI, Frankreich / FZ-Jülich, Deutschland / MPI-Halle, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

AIXTRON Taiwan
NCSR-D, Griechenland / IMEC, Belgien / IBM, Schweiz / CEA-LETI, Frankreich / STMicroelectronics, Frankreich / NXP Semiconductors, Belgien / University of Glasgow, Großbritannien / Katholike Universitaet Leuven, Belgien
Adixen: Alcatel VacuumTechnology France SAS, Frankreich / AIS Automation Dresden GmbH, Deutschland / AIXTRON SE, Deutschland / ASM International NV, Niederlande / ASML Netherlands B.V., Niederlande / Bronkhorst, Niederlande / CEA-LETI, Frankreich / EV Group E. Thallner GmbH, Österreich / Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik(Fraunhofer IOF), Deutschland / Fraunhofer Institut für integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (Fraunhofer IISB), Deutschland / HAP GmbH, Deutschland / IBS Precision Engineering B.V., Niederlande / IMEC, Belgien / Intel Performance Learning Solutions, Irland / Mattson Thermal Products GmbH, Deutschland / NanoPhotonics GmbH, Deutschland / PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt), Deutschland / Oxford Intruments Plasma Technology Ltd., Großbritannien / PVA TePla AG, Deutschland / SemiQuarz GmbH, Deutschland / Recif Technologies SAS, Frankreich / SEMILAB Semiconductor Laboratory Co Ltd, Ungarn / Siltronic AG, Deutschland / S.O.I.TEC Silicon on Insulator S.A., Frankreich / TNO, Niederlande / Vistec Electron Beam GmbH, Deutschland / Xycarb Ceramics BV, Niederlande
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

AIXTRON SE, Deutschland / Danish Technological Insitute, Dänemark / Eindhoven University of Technology, Niederlande / Forschungszentrum Jülich GmbH & Jülich-Aachen Research Alliance, Deutschland / Ruhr Universität Bochum, Deutschland / Technische Universität Wien, Österreich / University of Helsinki, Finland / University of Padova, Italien
Das Konsortium im Projekt „HEA2D“ untersucht die Grundlagen für durchgehende Verarbeitungsketten von 2D-Nanomaterialien mit dem Ziel Prozesse für die Serienfertigung zu entwickeln.
AIXTRON SE, Deutschland / Freie Universität Berlin, Deutschland / Helmholtz Zentrum Berlin, Deutschland
Gefördert von Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), Deutschland / Slowakische Akademie der Wissenschaften, Slowakische Republik / Technische Universität Wien, Österreich / Universität Padua, Italien / AIXTRON SE, Deutschland / Artesyn Austria GmbH & Co. KG, Österreich / EpiGaN, Belgien / Infineon Technologies Austria AG, Österreich
FBH, Deutschland / FCM, Deutschland / OSRAM, Deutschland / Fraunhofer IAF, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Uni Montpellier, Frankreich / Epichem, Großbritannien / SAES Getters, Italien
RWTH Aachen, Deutschland / Head Acoustics, Deutschland / Uni Twente, Niederlande / University of Tel Aviv, Israel / EKD, Spanien / NetKnowledge, Israel / Cerobear, Deutschland / Morskate, Niederlande / Optibase, Israel
Philips Technologie GmbH, Deutschland / AIXTRON SE, Deutschland / BASF SE, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

ASM International, Niederlande / Air Liquide, Frankreich / Bronkhorst, Niederlande / Conti Temic Microelctronic, Deutschland / Infineon Technologies, Deutschland / NXP Semiconductors, Belgien und Niederlande / Oxford Instruments, Großbritannien / R3T GmbH, Deutschland / SAFC Hitech, Großbritannien / STMicroelectronics, Frankreich / CEA-LETI, Frankreich / IHP, Deutschland / IMEC, Belgien / Technical University of Eindhoven, Niederlande / Tyndall National Institute, Ireland / University of Helsinki, Finnland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

FZ Jülich, Deutschland / AIR Liquide, Frankreich / LMPG, Frankreich / Epichem, Großbritannien / Jobin Yvon, Frankreich / CEA-LETI, Frankreich / ST Microelectronics, Frankreich
ST Microelectronics, Frankreich / ST Microelectronics, Italien / IMEC, Belgien / LMPG, Frankreich / CEA-LETI, Frankreich / LTM, Frankreich / AIR Liquide, Frankreich / Jordan Valley, Israel / NCSR, Griechenland / MDM, Italien / Sigma Aldrich, Großbritannien
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

INOVA LISEC TECHNOLOGIEZENTRUM GMBH, Austria / PROFACTOR GMBH, Austria / ENERGY GLAS GMBH, Germany / DURST PHOTOTECHNIK SPA, Italy / TIGER Coatings, Italy / CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Italy / UNIVERSITÄT LINZ, Austria / UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK / UNIVERSITÄT KASSEL, Germany / KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION, Republic of Korea
CEA-LETI, Frankreich / IMEC, Belgien / Acreo, Schweden / Schott, Deutschland / Alcatel Thales, Frankreich / ASMI, Niederlande / EPIC, Europäische Organisation / VDI-TZ, Deutschland / CNOP-OV, Frankreich / Yole Development, Frankreich
EPFL, Switzerland / Jacobs University Bremen, Germany / University of Dublin, Ireland / Institute Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenia / Weizmann Institute of Science, Israel / SCM, Netherlands / Evonik Industries AG, Germany
Alcatel Thales III-V Lab, Frankreich / Czech Technical University, Tschechische Rebublik / Element Six Ltd., Großbritannien / EPFL, Schweiz / Fcubic AB, Schweden / FORTH, Griechenland / Gwent Electronic Materials Ltd., Großbritannien / University Of Glasgow, Großbritannien / Impact Coatings AB, Schweden / IEE, Slovakei / CNRS, Frankreich / Instytut Technologii Elektronowej, Polen / IVF, Schweden / Université Grenoble, Frankreich / MFA, Ungarn / MicroGaN GmbH, Deutschland / SIFAM Fibre Optics, Großbritannien / STU, Slovakei / Universität Ulm, Deutschland / Universität Wien, Österreich / University Of Bath, Großbritannien / Vivid Components Ltd., Großbritannien
Konarka, Österreich / Photeon Technologies, Großbritannien / Uni Rom, Italien / Universität Linz, Österreich / University of Bath, Großbritannien / ILC, Slovakei / Holotools, Deutschland
Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland / Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland / Universitat de Valencia, Spanien / Installation Europeenne de Rayonnement Synchrotron, Frankreich / University of Cambridge, UK / University College Cork, Irland / Technische Universiteit Delft, Niederlande / Hochschule RheinMain, Deutschland / Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italien / Centro Ricerche FIAT S.c.P.A., Italien / Technische Universiteit Eindhoven, Niederlande
OSRAM, Deutschland / Fraunhofer IAF, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

TU Berlin, Deutschland / LayTec, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Universität Duisburg-Essen, Deutschland / AIXTRON SE, Deutschland
Würth Solar, Deutschland / ZSW, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Azzurro GmbH, Deutschland / MicroGaN GmbH, Deutschland / Infineon AG, Deutschland / SiCrystal AG, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Philips, Deutschland und Niederlande / CNRS, Frankreich / CNR-ISOF, Italien / Merck OLED Materials, Deutschland / Fraunhofer IPM, Deutschland / H.C. Starck, Deutschland / IMEC, Belgien / KU Leuven, Belgien / Universität Lecce, Italien / Novaled, Deutschland / OSRAM-OS, Deutschland / Academy of Sciences, Polen / Schott, Deutschland / Siemens, Deutschland / Syntec, Deutschland / Universität Dresden, Deutschland / Universität Ghent, Belgien / Universität Groningen, Niederlande / Universität Kassel, Deutschland / EPFL, Schweiz / Universität Strasbourg, Frankreich
OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Deutschland / Philips GmbH, Deutschland / BASF Future Business GmbH, Deutschland / Applied Materials, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

TEI of Crete (coordinator), Imperial College London (UK), University of Oxford (UK), Politechnico di Milan (IT), University of St-Andrews (UK), Cyprus University of Technology (CY), Johannes Keppler University of Linz (AT), University of Groningen (HOL), Friedrich-Alexander Universitat Erlangen -Nurnberg (GER), Institute of Electronic Structure and Laser – IESL (GR), Technion Israel Institute of Technology (ISR), NanoForce Ltd (UK), Solvay S.A. (BEL), Ceradrop (FR), Beneq (FIN), AIXTRON (GER)
Ziel des ERASMUS-Projekts "Life Long Learning (LLP)" auf dem Gebiet ‘Organische Elektronik & ihre Anwendungen - OREA´ ist die Förderung eines Masterstudiums (Curriculum MSc) in der Organischen Elektronik. Das Projekt nutzt die Synergien von Universität, Forschung und Industrie.
RWTH Aachen, Deutschland / FCT, Deutschland / Bruker Optik, Deutschland / AIS, Deutschland / Fraunhofer IWS, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Philips, Deutschland / RWTH Aachen, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

HMI, Deutschland / Merck OLED Materials, Deutschland
Im Rahmen des Verbundvorhabens PeroBOOST werden effektive bleifreie Solarzellen auf PerOwSkiT-Basis für die Energiewende erforscht entlang der Wertschöpfungskette, bestehend aus Ausgangsmaterialien, Abscheideverfahren, Solarzellenherstellung, Verkapselung und Skalierungsprozessen.
Der Fokus von AIXTRON's Teilprojekt besteht in der Erforschung von Verdampfungsprozessen und Anlagentechnik zur Abscheidung von PerOwSkiT Materialien. Wesentlicher Bestandteil der Arbeiten in PeroBOOST ist die Erforschung von innovativen Testständen und deren Skalierung.
European Netzwerk
Philips Technologie GmbH, Deutschland / AIXTRON SE, Deutschland / Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT, Deutschland / RWTH, Deutschland / ESI GmbH, Deutschland / LIMO Lissotschenko Mikrooptik GmbH, Deutschland
Gefördert vom NRW Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie
Philips Technologie GmbH, Deutschland / AIXTRON SE, Deutschland / Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT, Deutschland / Universität Köln, Deutschland
Gefördert vom NRW Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie
Universität Würzburg, Deutschland / Becker & Hickl GmbH, Deutschland / Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland / Universität Bremen, Deutschland / Forschungszentrum Jülich GmbH, Deutschland / qutools GmbH, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

CNRS, Frankreich / TU Berlin, Deutschland / University of Madrid, Spanien / University of Bologna, Italien / Alcatel Thales III-V Lab, Frankreich / University Of Glasgow, Großbritannien / Universität Jena, Deutschland / EPFL, Schweiz / University Of Warwick, Großbritannien / Universität Ilmenau, Deutschland / IFPAN, Polen / TKK, Finnland
IPHT, Deutschland / MPI, Deutschland / EMPA, Schweiz / MFA, Ungarn / Austrian Research Center GmbH, Österreich / VTT, Finnland / PICOSUN, Finnland / BiSOL, Slowenien / WTC, Deutschland / iSuppli, Deutschland / CalTech, USA
European Netzwerk
Infineon Technologies, Deutschland / Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen und Bauelementtechnologie, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Novaled AG, Dresden / Sensient Imaging Technologies GmbH, Westfälische Wilhelms Universität Münster / Fraunhofer IPMS, Dresden / Symboled GmbH / Fresnel Optics GmbH / Hella KGaA Hueck & Co / Siteco Beleuchtungstechnik GmbH / AEG-MIS mbH / Universität Paderborn
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Universität Würzburg, Deutschland / Universität Marburg, Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

University of Cambridge, Großbritannien / AIXTRON SE, Deutschland / Philips GmbH, Deutschland / IMEC, Belgien / Thales Research and Technology, Frankreich / Thales Electron Devices, Frankreich / Cambridge CMOS sensors, Großbritannien / Fritz Haber Institute, Deutschland / TU Berlin, Deutschland / Technical University of Denmark, Dänemark / Swiss Federal Institute of Technology, ETHZ
Freiberger Compound Materials GmbH (FCM), Deutschland / Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), Deutschland / University of Ulm, Deutschland / Nanoelectronic materials laboratory GmbH (NaMLab), Deutschland / Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik (IAF), Deutschland
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

AMD, Deutschland / Infineon, Deutschland / Wacker Siltronic, Deutschland / FZ Jülich, Deutschland / MPI, Deutschland / IMEC, Belgien
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

OSRAM Optosemiconductors, Deutschland / Royal Philips Electronics, Niederlande / BASF Future Business GmbH, Deutschland / BASF, Deutschland
Der Begriff AVD® ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Thales-TRT, Frankreich / CNRS, Frankreich / TU Wien, Österreich / Academy of Science, Slovakei / EPFL, Schweiz / FORTH, Griechenland / Universität Ulm, Deutschland
RWTH Aachen, Deutschland / mecca neue medien, Deutschland / JET Lasersysteme, Deutschland
Universität Hong Kong, China / Universität Tsinghua, China / RWTH Aachen, Deutschland
Ziel des Projektes ist die Erforschung von zukunftsweisenden vertikalen Transistorarchitekturen. Dabei sollen leistungsfähige Transistoren mit niedrigen statischen und dynamischen Verlusten und hoher Spannungsfestigkeit auf defektarmen GaN-Substraten entwickelt und getestet werden. AIXTRON SE wird die MOCVD-Technologie zur Abscheidung der notwendigen Schichtstrukturen grundlegend untersuchen und weiterentwickeln. Zur Optimierung der Technologie erfolgt die Herstellung und Untersuchung von geeigneten Schichtstrukturen. Danach erfolgt der Austausch von Schichten mit den anderen Projektpartnern, um Bauelemente herzustellen und zu verbessern. Die Rückkopplung der Erkenntnisse von den Projektpartnern dient der Verbesserung der Technologie. Im Rahmen des Projekts soll eine Analyse des Abscheideprozesses erfolgen, die zur weiteren Optimierung für die hier angestrebte Anwendung für Leistungstransistoren dienen kann.
Ziele für AIXTRON sind insbesondere:
· Entwicklung einer Technologie zur gleichzeitigen MOCVD-Beschichtung von mehreren Substraten
für GaN-basierte vertikale Leistungstransistoren.
· Verständnis der limitierenden und kostentreibenden Effekte bei der MOCVD-Technologie.
· Korrelation der Bauelement- und Schaltungseigenschaften mit der Epitaxie.
· Verständnis und Kontrolle der Schichteigenschaften und deren Verteilung über die gesamte
Waferfläche eines großen Wafers beim MOCVD-Prozess.
· Kostenaspekte und Aspekte der Industrietauglichkeit der Epitaxie basierend auf technisch/wissenschaftlichen Daten und Modellvorstellungen.
Die Herausforderung
Wirtschaft und Gesellschaft werden zunehmend elektrifiziert, um CO2-Ausstoß zu reduzieren. In einer solchen elektrischen Zukunft muss die elektrische Spannung auf ihrem Weg von der Primärenergieversorgung über die Zwischenspeicherung bis zum Endverbraucher mehrfach gleichgerichtet und invertiert werden, einschließlich der Umwandlung des Spannungspegels. Eine effiziente Leistungsumwandlung mit hochentwickelten Leistungstransistoren auf jeder Stufe ist daher zwingend erforderlich, um die Energieverschwendung zu minimieren.
Leistungstransistoren auf der Grundlage von Halbleitern mit breiter Bandlücke (WBG), wie Galliumnitrid (GaN), können die Effizienz leistungselektronischer Systeme verbessern, indem sie die derzeit verwendeten Leistungsschalter auf Siliziumbasis ersetzen. Aufgrund ihrer überlegenen Schalt- und Leitungseigenschaften eignen sie sich für nahezu alle Anwendungen, bei denen eine effiziente Leistungsumwandlung erforderlich ist, z. B. in den Bereichen Elektromobilität, Verkehr, erneuerbare Energien, Stromnetze oder industrielle Anwendungen. In einer elektrifizierten Zukunft sind sie daher ein wichtiger Baustein, um Verluste zu reduzieren und Energie zu sparen. Allerdings sind die Kosten für WBG-Halbleiter deutlich höher als für herkömmliche Leistungsbauelemente auf Siliziumbasis, was ihre Anwendung teilweise behindert.
Im Rahmen des YESvGaN-Projekts wird eine neue Klasse von WBG-Leistungstransistoren auf der Grundlage von Galliumnitrid (GaN) entwickelt, die sowohl erschwinglich als auch hocheffizient sein werden. Dies wird durch so genannte vertikale GaN (vGaN)-Membrantransistoren erreicht, die für die Umwandlung bei Spannungen bis zu 1200 V und Strömen bis zu 100 A geeignet sind. Die Entwicklung dieser neuen Transistoren wird Innovationen in mehreren Teilen der Halbleiterprozesskette umfassen, wie kostengünstige Substrate mit dicker Epitaxie, vertikale Membranansätze oder Mehrfachtransistorkanalkonzepte. Um die übergeordneten Projektziele zu erreichen, bündelt das YESvGaN-Konsortium die Erfahrung und Kompetenz von 23 Industrie- und Forschungspartnern aus 7 europäischen Ländern mit einem Gesamtbudget von fast 27 Mio. €. AIXTRON verbessert das MOCVD-Verfahren zur Herstellung dieser fortschrittlichen Leistungsbauelemente und optimiert die MOCVD-Reaktortechnologie.
Dieses Projekt wurde vom ECSEL Joint Undertaking (JU) unter der Fördervereinbarung Nr. 101007229 gefördert. Das Gemeinsame Unternehmen wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union sowie durch Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Schweden, Spanien und Italien unterstützt.
Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Deutschland kofinanziert.
Galliumnitrid (GaN) ist ein Material mit großer Bandlücke, dass die Leistungselektronik auf die nächste Stufe heben könnte. Der flächendeckende Einsatz von Bauelementen auf GaN-Basis wird die Entwicklung leistungselektronischer Systeme ermöglichen, bei denen die Energieverluste gegen Null gehen und das Volumen/Gewicht sowie die Systemkosten deutlich geringer sind.
Das von der EU geförderte Projekt GaN for Advanced Power Applications (GaN4AP) plant, GaN-basierte Elektronik zur primären Technologie für aktive Bauteile in allen Leistungsumwandlungssystemen zu machen. Das Projekt zielt auf die Entwicklung innovativer leistungselektronischer Systeme, innovativer Materialien und einer neuen Generation von vertikalen Leistungsbauelementen auf der Grundlage von GaN ab. Außerdem sollen neue intelligente und integrierte GaN-Lösungen sowohl in System-in-Package- als auch in monolithischen Varianten entwickelt werden.
Die Entwicklung neuer Stromversorgungsgeräte und -schaltungen mit GaN-basierter Elektronik ist für die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie von entscheidender Bedeutung.
Das GaN4AP-Konsortium deckt alle grundlegenden Bausteine der Wertschöpfungskette ab, vom Hersteller der GaN-Bauteile über die Montage bis hin zum Endverbraucher in der Automobilindustrie, ergänzt durch führende akademische Institute und anderer Anbieter von Werkzeugen und Dienstleistungen (Simulationssoftware, Messwerkzeuge usw.).
Das GaN4AP-Projekt zielt auf die folgenden Märkte:
AIXTRONs maßgeschneiderte MOCVD-Anlagen sind die Schlüsseltechnologie für die Entwicklung und Herstellung von Verbindungs-Halbleitern. Zu den vielen Vorteilen der AIXTRON Planetary Reactors® und des Shower Head Reactors gehören eine benutzerfreundliche Bedienung, eine hervorragende Prozessstabilität sowie sehr hohe Precursor-Effizienzen und die weltweit besten Homogenitäten in der Beschichtung. Zusammen mit der exzellenten Zuverlässigkeit und dem hohen Durchsatz führen all diese Eigenschaften zu einer wertvollen Anlagenausbeute und einer hohen Betriebszeit. AIXTRON wird seine Kompetenz in der Entwicklung und Anpassung von CVD-Anlagen sowie seine umfangreichen Erfahrungen in der Hetero-Epitaxie von III-V-Verbindungshalbleiterstrukturen, Heteroübergängen, LED und Transistoren einbringen.
Dieses Projekt wurde vom ECSEL Joint Undertaking (JU) unter der Fördervereinbarung Nr. 101007310 gefördert. Das Gemeinsame Unternehmen wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union unterstützt.
https://www.gan4ap-project.org
Das Projekt PowerElec konzentriert sich auf die Entwicklung neuartiger metrologischer Methoden und Instrumente, die Produktivität der Leistungselektronikindustrie deutlich zu verbessern.
Die Elektrifizierung des Verkehrs, die intelligente Stromverteilung und die 5G/6G-Kommunikation sind von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung des europäischen Green Deal und eine Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU. Die Leistungselektronik ist für diese Technologien von entscheidender Bedeutung, und europäische Unternehmen sind führend beim Übergang von Silizium zu Verbindungshalbleitern mit breiter Bandlücke. Diese Materialien bieten enorme Vorteile in Bezug auf die Leistung, aber die Fertigungsausbeute und die langfristige Zuverlässigkeit werden durch Materialfehler beeinträchtigt, die mit den bestehenden Techniken in der Fertigungsanlage nur schwer zu erkennen und zu charakterisieren sind. Ziel des PowerElec-Projekts ist es, Messtechniken zu entwickeln, die diese Einschränkungen überwinden. Dies soll durch die gemeinschaftlichen Bemühungen von nationalen Metrologie-Instituten und der Partnern aus Industrie und Wissenschaft gelingen. Im Rahmen des Projekts nutzt AIXTRON die Kompetenz der Partner, um die möglichen Defekte in den durch MOCVD gezüchteten Halbleiterschichten zu verstehen und auf der Grundlage dieses Wissens die AIXTRON MOCVD-Technologie weiter zu verbessern.
Das Projekt PowerElec wird von EMPIR - The European Metrology Programme for Innovation and Research - unterstützt, das europäische Metrologie-Institute, Hochschulen und die Industrie zusammenbringt, um neue Herausforderungen in der Metrologie zu bewältigen.
Herstellung von Graphen im industriellen Maßstab
Graphen besteht nur aus einer Lage von Kohlenstoffatomen und gilt seit seiner Entdeckung als „Wundermaterial“. Besonders interessant ist die extreme Festigkeit bei gleichzeitiger Biegsamkeit des Materials. Auch weist es eine höhere elektrische Leitfähigkeit als Metalle auf und ist noch dazu transparent. Die einzigartigen Eigenschaften des dünnsten Materials der Welt könnten vielfältige Anwendungen ermöglichen, bisher sind jedoch sehr wenige Produkte auf dem Markt. Einige Verbesserungen konnten bspw. bei Sensoren zu einer deutlich gesteigerten Sensitivität führen. Auch konnten Transistoren, Herzstück in der Nachrichtentechnik oder in Computersystemen, mit besonders hoher Taktfrequenz realisiert werden. Es handelt sich bislang jedoch nur um Labordemonstrationen, nicht um produktionstaugliche Prozesse. Das dringendste Problem ist die nicht einwandfrei definierte und reproduzierbare Qualität der Graphenschichten. Für eine Umsetzung im industriellen Maßstab ist aber eine hohe und zuverlässig reproduzierbare Qualität der elektrisch funktionalen Materialien unabdingbare Voraussetzung.
Mit der Gasphasenabscheidung steht grundsätzlich ein skalierbarer Prozess für die Herstellung großflächiger Graphenschichten zur Verfügung. Im Projekt GIMMIK soll die Herstellung von Graphenschichten erstmals unter industriellen Rahmenbedingungen evaluiert werden. Die Schwachstellen bei der entsprechenden Prozessierung werden identifiziert und Wege zur Eliminierung der Fehlerquellen entwickelt. Darüber hinaus soll die Übertragung der Eigenschaften von Graphen auf elektrische Bauteile durch Integration in eine Materialumgebung überprüft werden. Dieser Aspekt soll mit Fokus auf die Bewertung der Graphenqualität, aber auch im Hinblick auf die Verbesserung der Bauteileigenschaften untersucht werden. Parallel werden Verfahren zur großflächigen, kontaktfreien Charakterisierung von Graphen entwickelt, die derzeit noch nicht existieren. Projektziel ist die Erstellung von Methodiken zur Sicherstellung einer gleichmäßig hohen Graphenqualität als Grundlage der Fertigungstauglichkeit für Abscheidungs- und Integrations-Prozesse.
Das Forschungsvorhaben GIMMIK hat zum Ziel, die Graphentechnologie für elektronische Bauelemente zu erweitern und auf einen produktionsrelevanten Stand zu bringen. Im Erfolgsfall gelingt ein internationaler Durchbruch in der industriellen Anwendung von Graphen, der aufgrund des hohen Verwertungspotentials die beteiligten Unternehmen und Deutschland als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort international stärkt.
Teilnehmer: AIXTRON SE, Deutschland (Herzogenrath) / Infineon Technologies AG, Deutschland (Neubiberg) / IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik, Deutschland (Frankfurt, Oder) / Protemics GmbH, Deutschland (Aachen) / LayTec AG, Deutschland (Berlin) / RWTH Aachen, Deutschland (Aachen)
Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Das Graphene-Flaggschiff ist Europas 10-jähriges, mit 1 Mrd. Euro gefördertes Programm, das im Oktober 2013 angelaufen ist. Das Flaggschiff stellt eine neue Form der gemeinsamen, koordinierten Forschung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß dar und bildet die größte europäische Forschungsinitiative aller Zeiten. Das Programm wird in Form von Kurzprojekten finanziert, und wir befinden uns jetzt in der "Core 3"-Phase.
Das Graphen-Flaggschiff hat die Aufgabe, akademische und industrielle Forscher zusammenzubringen, um innerhalb von 10 Jahren Graphen aus dem Bereich der akademischen Laboratorien in die europäische Gesellschaft zu bringen und so Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze und neue Möglichkeiten zu schaffen.
Bei diesem Projekt hat AIXTRON zwei wichtige technische Aufgaben:
(1) die Entwicklung eines automatisierten Transfersystems zur Realisierung der Backend-Integration von Graphen auf 300-mm-Wafern;
(2) die Entwicklung eines Rolle-zu-Rolle-Wachstums von Graphen auf Kabeln zur Verbesserung des Korrosionsschutzes und der elektrischen Leistung;
Was die Leitung des Projekts betrifft, so ist Dr. Ken Teo der Vorsitzende des Exekutivausschusses, der das Entscheidungsgremium des Flaggschiffs ist; Dr. Alex Jouvray leitet das Arbeitspaket Produktion.
Weitere Informationen: Graphene Flagship
Die Anforderungen an Elektrofahrzeuge steigen heutzutage. Als wesentlicher Bestandteil, Hochleistungsbatterien in der großen Nachfrage, die spezifische technische Eigenschaften und präzise Fertigung erfordern. Die Eigenschaften von Stromabnehmern bestimmen in hohem Maße die Leistung der Leistungsbatterie. Herkömmliche Metallfolien können nur einer schwachen Bindung des aktiven Materials standhalten und sind sehr anfällig für Sulry/Elektrolyt. Um dieses technische Problem zu lösen, haben wir eine Kondensationsabscheidung von Carbon Nanotube (CNT)-Wald mittels CVD durchgeführt, die durch unsere einzigartige Technologie von Rolle zu Rolle skaliert werden kann. Die CNT-Abscheidungsschicht kann sowohl gegen saure Sulry als auch gegen organische Elektrolyte vor direktem Kontakt mit Metallfolie schützen. Darüber hinaus kann es auch eine bessere mechanische Verbindung zwischen CNT und elektrodenaktiven Materialien herstellen und so eine bessere elektrochemische Leistung für Power-Batterien bieten. In diesem Projekt möchten wir die Vorteile von AIXTRON bei der CVD- und CNT-Depositionstechnik mit den Vorteilen der anderen Projektpartner bei der Herstellung und dem Markt kombinieren.
Ziel des Projekts ist die Innovation eines neuen Produkts (nano-carbonbeschichtete Stromabnehmer) für leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien (LIBs) für Elektrofahrzeuge (EVs). Dieses Produkt ist ein notwendiges Zubehör für High-End-Batteriehersteller und stellt so mit relativ geringem Verkaufsaufwand eine einzigartige und profitable Marktchance für Weimu dar. Um einen erfolgreichen F&E-Output zu erreichen, sind die Hauptziele und Aktivitäten im Folgenden aufgeführt:
Ziele:
1. Entwicklung von Fertigungseinrichtungen und -techniken für spezielle industrielle Anforderungen,
2. Überzeugende Proben mit besserer Leistung als aktuelle LIBs,
3. Demonstration der Skalierbarkeit für Fertigung und Produktion.
Aktivitäten:
1. Herstellung von mit Nanokohlenstoff beschichteten Proben auf der Grundlage von Anforderungen, die mit Hilfe der vorhandenen AIXTRON-Forschungsanlage im Batch-Betrieb durchgeführt werden können.
2. Überprüfen und testen Sie beschichtete Proben in LIB-Knopfzellen,
3. Vergrößerung des Prozesses durch die Entwicklung einer Rolle-zu-Rolle-Fertigungsanlage,
4. Herstellung konventioneller LIBs im Maßstab für weitere Tests, 5. Sicherstellung des Endprodukts, der Kosten und der Eigenschaften.
Die Innovation, die dieses Projekt demonstriert, ist die Durchführung eines Trockenverfahrens zur Beschichtung von LIB-Stromabnehmern mit Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT). In aktuellen LIBs sind Stromabnehmer hauptsächlich Aluminiumoxidfolien für die Kathode, Kupferfolien für die Anode. Blanke Metallfolien sind anfällig für Oxidation und Korrosion. Außerdem sind sie schwach mit der angrenzenden Elektrodenschicht verbunden. Um das Problem zu lösen, werden derzeit Lösungen mit einer dünnen Kohlenstoffschicht 2~5μm zur Verbesserung der Grenzflächeneigenschaften angeboten. Bei diesem Verfahren handelt es sich jedoch um einen Nassprozess, der eine lange Verarbeitungszeit und eine zusätzliche Lösungsmittelmischung erfordert. Daher hat es viele Vorteile, einen solchen Nassprozess durch einen Trockenprozess zu ersetzen, der auf unserer einzigartigen Nano-Kohlenstoff-Abscheidungsmethode basiert. Die Schritte konnten reduziert werden, so dass die Produktionszeit im Vergleich zu aktuellen Lösungen relativ gering ist. Außerdem wäre die gelöschte Nano-Kohlenstoff-Beschichtung auch von besseren Eigenschaften, die wertvoller sind als bisherige Lösungen.
Das neue Produkt zielt auf die Verbesserung der Produkteigenschaften sowie der Produktionseffizienz in der Großserienfertigung ab.
Neue Pilotanlage wird in Zukunft der Inkubator für multinationale Unternehmen der Photonik sein.
Die Photonik ist eine aufstrebende Technologie mit einem potenziellen Multitrillionenmarkt. Innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen bei dieser Entwicklung an vorderster Front, aber die FuE-Kosten sind für sie unerschwinglich. Deshalb gründen 12 Partner aus Nordwesteuropa eine Open-Access-Pilotlinie, die Kosten und Zeit für die Pilotproduktion neuer Produkte drastisch reduzieren wird. Diese neue Einrichtung wird voraussichtlich das Inkubatorzentrum von tausend neuen Unternehmen und Tausenden von Arbeitsplätzen sein. Das 14-Millionen-Euro-Projekt (OIP4NWE) wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt und beginnt diese Woche in Eindhoven.
Die Photonik ist vergleichbar mit der Elektronik, aber anstelle von Elektronen verwendet sie Licht (Photonen) als Arbeitspferd. Sie verbraucht viel weniger Energie, ist schneller und eröffnet eine Fülle neuer Möglichkeiten. Eines der Hauptprobleme, das die Photonik lösen wird, ist der explodierende Energieverbrauch von Rechenzentren, da photonische Mikrochips viel weniger Energie verbrauchen als ihre elektronischen Vorgänger. Ein weiteres Beispiel für die Anwendung von photonischen Bauelementen ist ein hochpräzises Überwachungssystem für Flugzeugflügel, Brücken oder hohe Gebäude.
Nach zwei Jahrzehnten der photonischen Grundlagenforschung starten nun die ersten Unternehmen, die photonische integrierte Schaltungen (PICs) herstellen. Eine der Haupthindernisse sind die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung. Die PIC-Produktion erfordert nicht nur teure High-Tech-Geräte, die in Reinräumen installiert sind, sondern auch die Produktionsprozesse weisen derzeit noch eine hohe Fehlerquote auf und sind zu langsam. Dies war für die Grundlagenforschung vertretbar, nicht aber für die kommerzielle Forschung. Die Bewertung der technologische Einsatzbereitschaft (technology readiness level, TRL), die von 1 bis 9 reicht, muss von den aktuellen 4 auf das Niveau 7 angehoben werden.
Das neue Projekt unter der Leitung der Photonik-Hochburg Eindhoven University of Technology (in Zusammenarbeit mit dem Photonic Integration Technology Center) umfasst die Realisierung einer effizienten Pilotproduktionslinie zur gemeinsamen Nutzung durch europäische KMU. Das Projekt sollte die Fehlerquote in der Pilotproduktion verringern und die Durchlaufzeit verkürzen. Alles in allem sollte dies zu einer Kostensenkung führen, die die Schwelle für die Entwicklung neuer photonischer Produkte deutlich senkt. Dies dürfte dazu beitragen, innerhalb von zehn Jahren nach dem Projekt viele integrierte Photonikfirmen zu gründen.
Der Frontend-Prozess (Herstellung von PICs auf Indiumphosphid-Wafern) wird in der bestehenden Reinraumanlage NanoLab@TU/e der Universität Eindhoven realisiert. Die PICs verschiedener Unternehmen werden auf einem Wafer zusammengefasst, um die Kosten niedrig zu halten. Der Backend-Prozess wird an der Vrije Universiteit Brussel (Optiken für Strahlformung und Lichtkupplung) und am Tyndall National Institute in Cork, Irland (Montage von Glasfaserverbindungen und Elektronik im Gehäuse) durchgeführt. Alle Schritte erfordern nanoskalige Präzision, um Produktfehler zu vermeiden.
Die erste Phase des Projekts ist die Installation der Ausrüstung. Die zweite Stufe konzentriert sich auf die Automatisierung der Anlagen, während die dritte Stufe intensive industrielle Forschung zusammen mit den Anlagenherstellern zur Optimierung und Entwicklung neuer Verfahren beinhaltet. Die Pilotlinie soll 2022 vollständig in Betrieb sein. Um die Erstakzeptanz durch die KMU zu fördern, wird ein Gutscheinprogramm für externe KMU eingerichtet.
Weitere Beteiligte neben AIXTRON SE (Deutschland) sind die Unternehmen Oxford Instruments Nanotechnology Tools (Großbritannien), SMART Photonics, VTEC Lasers & Sensors, Technobis Fibre Technologies (alle Niederlande) und mBryonics Limited (Irland) sowie die Forschungszentren Photonics Bretagne (Frankreich), Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW (Deutschland) und Photon Delta Cooperatie (Niederlande).
Das Projekt hat ein Gesamtbudget von 13,9 Millionen Euro. Davon finanziert die EU 8,3 Millionen, der Rest kommt von den beteiligten Parteien.
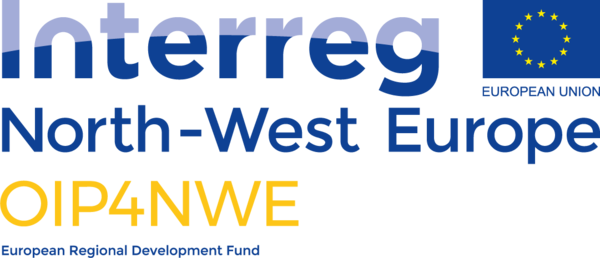
Presseinformation Protoype AIXTRON epitaxy reactor for open innovation pilot line OIP4NWE
SKYTOP zielt darauf ab die Kombination von topologischem Zuständen sowohl im realen als auch im reziproken Raum durch die Verwendung von Topologischen Materialien (TM) wie Topologischen Isolatoren und/oder Weyl-Halbmetallen und magnetischen Skyrmionen zu ermöglichen. Ziel ist es, eine Skyrmion-TM-basierte Plattform zu entwickeln und Geräte mit ineinandergreifenden elektronischen Spins und Topologien für verbesserte Effizienz und neue Funktionen zu realisieren. Diese sollen zu einem neuen Paradigma für die ultradichte niederleistungs-Nanoelektronik führen. Die drei Hauptziele dieser Vision sind: die Entwicklung von TM-Materialien für eine hocheffiziente Erzeugung von Spin-Strömen und Steuerung der Magnetisierung; als auch die Entwicklung einer funktionalen TM-Skyrmion-Plattform. Diese Arbeiten sollen die Skyrmionen eine Technologiestufe höher heben. Die Demonstration des Potenzials dieser Plattform erfolgt durch die Realisierung von zwei exemplarischen unkonventionellen Geräten: einem rekonfigurierbaren Hochfrequenz-Skyrmion-Filter und einem neuromorphen Gerät auf Basis von Skyrmion-Gas. SKYTOP wird voraussichtlich auch eine Route zur Erschließung der entstehenden Weyl-Halbmetallmaterialien eröffnen. Diese werden derzeit auf der Ebene der Grundlagenforschung untersucht.
Teilnehmer: National Center for Scientific Research “Demokritos” (NCSRD, Griechenland, Koordinator) / Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Frankreich) / Thales (Frankreich) / Max-Planck-Insituts (MPI, Deutschland) / Consiglio Nazionale delle Ricerch –Institute for Microelectronics and Microsystems (CNR-IMM, Italien) / Interuniversity Micro-Electronics Center (Imec, Belgien) / AIXTRON (Deutschland)
Gefördert durch die Europäische Kommission
SKYTOP Project EU: Skyrmion-Topological insulator and Weyl semimetal technology (Video)
Die Digitalisierung und die zugrunde liegenden Schlüsseltechnologien sind ein wesentlicher Bestandteil der Antworten auf viele der gewaltigen Herausforderungen, vor denen die Gesellschaften heute stehen. Die wichtigsten Voraussetzungen für diese digitale Transformation sind elektronische Komponenten und Systeme (ECS), die in Anwendungen, Information Highways und Rechenzentren eingesetzt werden. Diese Informationsautobahnen und Rechenzentren sind das "Rückgrat" der gesamten Digitalisierung (5G) und elektrische Energie ist die wesentliche Ressource, die sie antreibt. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Datenverkehr, -speicherung und -verarbeitung ist eine höhere Energieeffizienz unumgänglich. Dies gilt auch für die Energieumwandlung in Bezug auf Smart Grids und Smart Mobility.
Wann immer Halbleiterbauelemente auf Silizium-(Si)-Basis an ihre Grenzen stoßen, sind Leistungshalbleiter auf Galliumnitrid-(GaN)-Basis vielversprechende Kandidaten, die wesentlich höhere Schaltfrequenzen bei gleichzeitig höchster Energieumwandlungseffizienz ermöglichen. Mehrere FP7- und H2020-Projekte, darunter das ECSEL-Pilotprojekt "PowerBase", haben diese Annahmen bestätigt und dienen als Grundlage für die Verfügbarkeit der ersten Generation europäischer GaN-Geräte. Neben dem Nachweis der Fähigkeit, effizientere und kompaktere Anwendungen durch den Einsatz von GaN-Bauelementen zu erreichen, machten diese Projekte deutlich, dass die Herausforderungen der GaN-Technologien stark unterschätzt wurden. Daraus ergibt sich eindeutig die Notwendigkeit, GaN weiter zu untersuchen und die Forschungsaktivitäten auf Größenreduzierung, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit bei der Bewältigung großer Herausforderungen zu konzentrieren:
Höhere elektrische Felder (Driftphänomene, die die Lebensdauer beeinflussen),
Höhere Stromdichten (Elektromigration wirkt sich auf die Lebensdauer aus),
Höhere Leistungsdichten (thermische Probleme, die das Kompaktheitspotenzial einschränken).
Diese Herausforderungen bilden eine "rote Ziegelwand" für die nächsten Generationen der GaN on Si-Technologie, die das Schrumpfen von GaN-Bauteilen behindert, was notwendig ist, um deren Erschwinglichkeit zu verbessern und damit das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.
Der RIA-Projektvorschlag UltimateGaN wird die rote Ziegelwand überwinden und sich auf die GaN-Technologie der nächsten Generation konzentrieren, die insbesondere sechs Hauptziele entlang und über die gesamte vertikale Wertschöpfungskette der Leistungs- und Hochfrequenzelektronik (RF) verfolgt:
Forschung an vertikalen Power-GaN-Prozessen und -Vorrichtungen, die die Leistung über den aktuellen Stand der Technik hinaus steigern,
Forschung an lateralen GaN-Technologien und -Geräten, um die beste Leistungsdichte und -effizienz ihrer Klasse zu erreichen und gleichzeitig die Kosten und die Leistung zu optimieren,
Dadurch wird die Leistung von GaN auf Silizium-HF nahe an GaN auf Siliziumkarbid herangeführt und ein kostengünstiger 5G-Rollout ermöglicht,
Überschreitung der Verpackungsgrenzen - Größe, elektrische und thermische Einschränkungen - für leistungsstarke GaN-Stromerzeugnisse,
Schließen Sie die Lücke zwischen Zuverlässigkeit und Fehlerdichte für die meisten innovativen GaN-Geräte,
Demonstration der europäischen Führungsrolle in den Bereichen Hochleistungselektronik und HF-Anwendungen.
Die ersten drei Ziele sind GaN-Technologie, die darauf abzielt, die Grenzen durch alternative Geräte- und Prozesskonzepte zu erkunden. Das vierte Ziel wird der Tatsache Rechnung tragen, dass die hervorragende Halbleiterleistung von GaN nur dann genutzt werden kann, wenn Montage/Gehäuse, Verbindungen und verbessertes Wärmemanagement in einem ganzheitlichen Ansatz optimiert werden. Die Gehäuse, die die einzigartige Leistung von Hochleistungs-GaN-Bauelementen voll ausschöpfen, sind heute noch nicht fertig und bedürfen daher weiterer Untersuchungen.
Die Bildung von Kristalldefekten, insbesondere an der GaN auf der Si-Schnittstelle, ist eines der größten Hindernisse für die Ausbeute und Zuverlässigkeit konkurrierender Si-basierter Technologien. Daher ist ein weiteres Hauptziel von UltimateGaN die Vermeidung dieser Defekte in der nächsten Generation von GaN auf Si-Bauelementen.
Die Forschungsergebnisse aus den Technologie- und Verpackungszielen werden im Rahmen des letzten Ziels, das sich mit anspruchsvollen Anwendungsfeldern für diese Hochleistungsgeräte befasst, genutzt und demonstriert. Unter anderem sind diese Anwendungsbereiche:
Extrem effiziente Server-Stromversorgung für einen geringeren Energieverbrauch in Rechenzentren (5G: Digitalisierungs-Backbone),
Benchmarking von Photovoltaik-Wechselrichtern in Bezug auf Effizienz und Größe zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien (Smart Grids: Energy Backbone),
Preiswerte 5G-Verstärker bis zur mm-Welle ermöglichen einen schnelleren 5G-Rollout (5G: Digitalisierungs-Backbone),
GaN-fähige, ultraschnell schaltende LIDAR-Anwendung für autonomes Fahren (Smart Mobility),
Höchster Wirkungsgrad μ-Netz-Wandler und On-Board-Ladegeräte (Smart Grids; Smart Mobility).
Das Projekt UltimateGaN wird höchste Effizienz in den spezifischen Bereichen der ausgewählten Anwendungen ermöglichen und zu einer signifikanten Reduzierung des CO2-Fußabdrucks durch Digitalisierung, intelligente Netze und intelligente Mobilität führen. Um die Rolle Europas in der Zukunft des GaN-Geschäfts zu stärken, müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um erschwingliche GaN auf Si-Transistoren der nächsten Generation zu erreichen. Da auch US-amerikanische und asiatische Unternehmen stark in diese Richtung investieren, ist es für Europa von größter Bedeutung, den Fortschritt in Richtung der nächsten Technologiegenerationen zu beschleunigen.
Teilnehmer: Österreich - Österreich Technologie & Systemtechnik AG, Infineon Technologies Österreich
AG, Fronius International GmbH, CTR Carinthian Tech Research AG, Technische Universität Graz |
Belgien - IMEC | Deutschland - AIXTRON SE, Infineon Technologies AG, Siltronic AG, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Technische Universität Chemnitz, NaMLab GmbH | Italien - Università degli studi di Padova, Infineon Technologies Italia, Universita di Milano Bicocca | Norwegen - Eltek AS | Slowakei - Slowakische Technische Universität in Bratislava, Nano Design SRO | Schweiz - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL, Attolight SA | Spanien - IKERLAN, For Optimal Renewable Energy, LEAR | Schweden - RISE Research Institutes of Sweden AB, SweGaN AB
Gefördert durch das Programm ECSEL JU (Electronic Component Systems for European Leadership Joint Undertaking) der Europäischen Union und kofinanziert durch die FFG (The Austrian Research Promotion Agency).
Video: UltimateGaN Project
Das QUANTIMONY-Konsortium ist ein Europäisches Innovatives Ausbildungsnetzwerk (European Innovative Training Network, ITN) mit einem Schwerpunkt auf dem Gebiet der Halbleiterwissenschaft und -technologie, das alle wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Aspekte von der Modellierung über Materialwachstum und -charakterisierung, Bauelementherstellung und -analyse bis hin zur industriellen Nutzung abdeckt.
Im Rahmen dieses neuen, von der EU finanzierten H2020, Marie Skłodowska-Curie Joint Training and Research Programme "Quantum Semiconductor Technologies Exploiting Antimony" (Gemeinsames Ausbildungs- und Forschungsprogramm "Quantenhalbleiter-Technologien zur Nutzung von Antimon-basierten Verbindungshalbleitern") stehen 14 Doktorandenstellen für hochmotivierte Nachwuchsforscher (Early Stage Researchers, ESRs) zur Verfügung.
Gesucht werden 14 junge talentierte ESRs, die in einem dieser Länder auf ihre Promotion hinarbeiten wollen: Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien und Großbritannien ab April/Juni 2021.
Das Projekt QUANTIMONY wird von der Europäischen Kommission (Kennzeichen 956548) gefördert.
Mehr Informationen (Website QUANTIMONY und Europäische Kommission)
Pressemitteilung: Klicken Sie bitte hier


TRANSFORM ist ein von der EU und nationalen Förderbehörden finanziertes Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Im Rahmen dieses Projekts soll eine vollständige und wettbewerbsfähige europäische Lieferkette für Leistungselektronik auf Basis der SiC-Halbleitertechnologie von Substraten bis hin zu Energiewandlern wie Transistoren bzw. Module aufgebaut werden. Sie soll als Versorgungsquelle für Siliziumkarbid-Komponenten und -Systemen in Europa dienen.
Eine solche Lieferkette leistet darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für eine ganzheitliche Optimierung leistungselektronischer Systeme, die für eine saubere und nachhaltige europäische Ökonomie erforderlich sind. Damit soll TRANSFORM dazu beitragen, dass Europa führend in der SiC-Technologie wird – einschließlich Gerätetechnologie und Anwendung nicht nur auf den derzeitigen 150 mm-Wafern, sondern auch den Wafern der nächsten Generation mit einer Größe von 200 mm. Dazu soll die Siliziumkarbid-Technologie der nächsten Generation entwickelt werden.
Die SiC-Technologie bietet vor allem Energieeinsparungen in Anwendungen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Industrie und Elektromobilität. Siliziumkarbid-basierte Leistungselektronik nutzt elektrische Energie deutlich effizienter als derzeitige silizium-basierte Bauelemente: Je nach Anwendung werden Einsparungen bis zu 30% erwartet.
Das Projekt umschließt auch die Entwicklung zentraler Anlagen wie produktionserprobte CVD-Abscheidesysteme (Chemical Vapour Deposition) mit hoher Ausbeute. Die beteiligten Anlagenhersteller entwickeln und optimieren dabei auch Prozesse und Gerätedesign zur Nutzung eines neuen Substratherstellungsverfahrens einschließlich der Anpassung von planarMOS- und der Entwicklung der neuen TrenchMOS-Technologie. Für SiC-Substrate soll ein neuer globaler Substratstandard „Smart Cut“ etabliert werden. Die Smart-Cut-Technologie ermöglicht hohe Skalierbarkeit, überlegene Leistung und Zuverlässigkeit.
Verbesserung der CVD-Anlagentechnologie für Siliziumkarbid (SiC)
Entwicklung einer Technologie zur gleichzeitigen CVD-Beschichtung von mehreren 200 mm-SiC-Substraten
CVD-Anlagentechnologie für Smart Cut SiC-Substrate
Vertiefung des Verständnisses der limitierenden und kostentreibenden Effekte bei der SiC/CVD-Technologie, der Korrelation der Bauelementeigenschaften mit der Epitaxie und das Verständnis und die Kontrolle der Schichteigenschaften und deren Verteilung über die gesamte Wafer-Fläche
Das Projekt TRANSFORM wird von der Europäischen Kommission (Kennzeichen 101007237) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (Kennzeichen 16MEE0131) gefördert.
Weitere Informationen:
AIXTRON Pressemitteilung
TRANSFORM-Website

Corporate Research & Development
Prof. Dr. Michael Heuken
Vice President Advanced Technologies
Alan Tai
Taiwan/Singapore
Christof Sommerhalter
USA
Christian Geng
Europe
Hisatoshi Hagiwara
Japan
Nam Kyu Lee
South Korea
Wei (William) Song
China
AIXTRON SE (Headquarters)
AIXTRON 24/7 Technical Support Line
AIXTRON Europe
AIXTRON Ltd (UK)
AIXTRON K.K. (Japan)
AIXTRON Korea Co., Ltd.
AIXTRON Taiwan Co., Ltd. (Main Office)
AIXTRON Inc. (USA)
Christoph Pütz
Senior Manager ESG & Sustainability
Christian Ludwig
Vice President Investor Relations & Corporate Communications
Ralf Penner
Senior IR Manager
Prof. Dr. Michael Heuken
Vice President Advanced Technologies
Christian Ludwig
Vice President Investor Relations & Corporate Communications